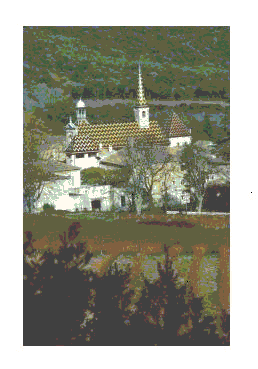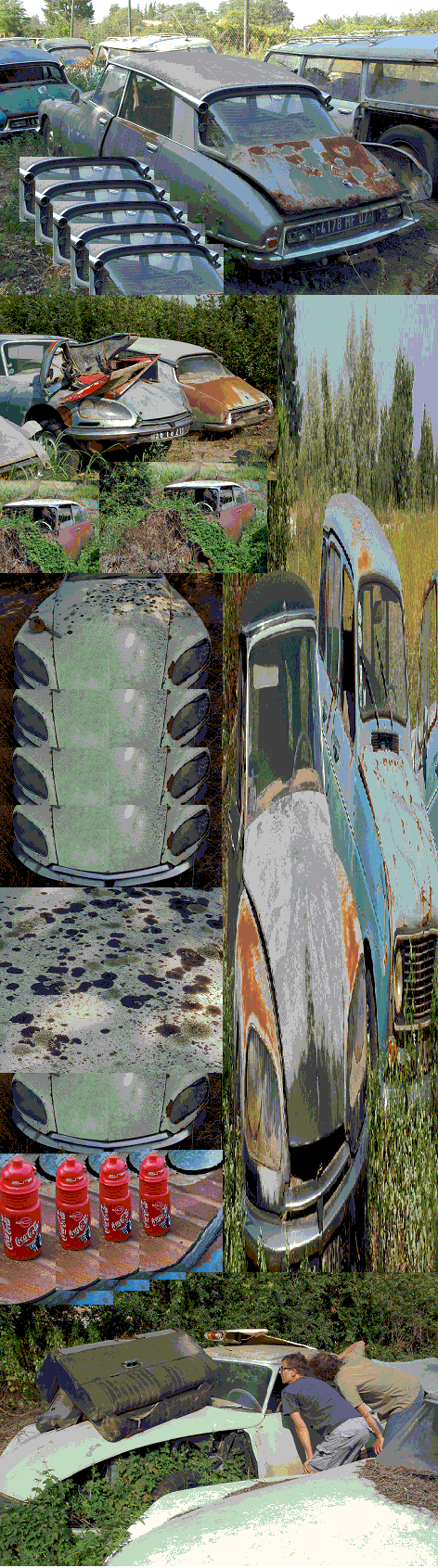Die Ausbildung soll sich vermehrt den Schülern anpassen – so eine der zehn grossen Ideen der Schweiz.
Im momentanen Vergleich mit Frankreich haben wir in der Bildung zumindest für die nicht elitären Bereiche einen recht grossen Vorsprung. Für die Schweiz wird aber noch Zusätzliches gefordert. Die Integration von Menschen aus bildungsfernen Schichten muss von der Grundschule bis zur Berufsausbildung besser erfolgen. Hans Ulrich Stöckling, Vorsteher Erziehungsdepartement, St. Gallen fordert zum Beispiel eine zusätzliche, weniger anspruchsvolle Berufsausbildung, eine sogenannte Attestausbildung.
Das wohl wichtigste Wort im letzten Satz ist «zusätzlich», denn damit wird nicht die bestehende Ausbildung verwässert und die guten Schüler brauchen sich nicht der Leistung und dem Tempo der weniger guten an zu passen. Das mag zwar auch heute noch einen Teil der Sozialdemokraten aufregen, aber wir müssen der Zukunft in die Augen sehen und das wird nicht nur ein angenehmes Leben mit einfachem Geldverdienen sein. Schon heute haben es einige Berufsgattungen schwer, gegen die asiatischen Dimensionen Paroli bieten zu können.
Auf diesem Gebiet wird der Kanton Bern am Modell 6/3, propagiert von Leni Robert wohl noch Jahre zu leiden haben. Baselland diskutiert zur Zeit das Model 5/4 zur Volksschulharmonisierung. Sechs Jahre Grundschule ist für gute Schüler eindeutig zu viel. Die Schweiz wird in Zukunft ihren Wohlstand nur halten können, wenn wir viele sehr gut ausgebildete Menschen im Land beschäftigen können. Die Selektion muss früh beginnen und für «Spätzünder» müssen Chancen zum späteren Wechsel, allenfalls auf einem anderen Bildungsweg, gegeben sein.
Wie wäre es mit einem Modell 4/4/4/4? Vier Jahre Grundschule und dann allenfalls ein Wechsel in die Sekundarschule, Realschule oder wie diese Stufe auch immer heissen möge. Wer 8 Jahre auf der weniger anspruchsvollen Stufe durchlaufen hat, sollte die Möglichkeit haben, dann eine Berufslehre in Angriff zu nehmen oder eine Attestausbildung. Und spätestens hier versagt Frankreich. Wer nicht in einem grossen Ballungsgebiet lebt, hat keine Möglichkeit, eine Berufschule zu absolvieren, wie wir sie in der Schweiz kennen. Jeder muss Glück haben eine Anstellung zu finden, bei der er einiges Lernen kann. Da sind zum Teil Welten zwischen dem Raum Paris und dem Südwesten.
Frankreich ist heute eine Welt der «Bastler» und mich erstaunt volkswirtschaftlich immer wieder, dass diese immer noch recht gut am Leben ist. Ein Beispiel. Die Pumpe der Quelle hat zu wenig Druck um die Bewässerung des Gartens gewährleisten zu können. Der Lösungsvorschlag: Gemeindewasser nehmen, das hat mehr Druck. Der «Bewässerungsspezialist» – ohne Ausbildung, wer es noch nicht gemerkt haben sollte – verweist im zweiten Anlauf auf den «Plombier» – den Bleilöter. Dann gibt es noch den Sourcier, den Sanitaire, eben den Arrosagier, den Kanalgräber, le pooliste und und und. Es bringt auch nichts, wenn Frankreich jetzt soweit ist und aus dem Angelsächsischen Berufsgruppen-Bezeichnungen ableitet, wie der jenige, der für den Swimming Pool verantwortlich ist. Chaos pur – aber so lebt man hier.
Die meisten on the job ausgebildeten Leute sind auch nur zuständig um neue Sachen von Grund auf zu machen – wehe, wenn eine Reparatur fällig ist und sich einer in die Gedankengänge anderer einarbeiten muss. Das Umdenken in der Ausbildung ist in Frankreich noch viel wichtiger als in der Schweiz. Bei uns funktioniert es zumal heute recht gut. Aber wie sieht dies in der Zukunft aus.
Fast jedem einigermassen durchschnittlichen Schüler wird in Frankreich ein Studium ermöglicht. Das Resultat ist Chaos pur. Die guten haben höchstens das Problem, dass das Tempo zu wenig forsch ist. Und die schlechteren oder diejenigen, die in Gegenden sind, wo man nicht Tausende von studierten Soziologen, Betriebswirtschaftern etc. braucht, arbeiten bei Intermarché, Champions oder einem andern Geschäft. Wenn es hoch kommt als Verkäufer und sonst an der Kasse. Die Tochter meines übernächsten Nachbarn lernt jetzt wenigstens Englisch in England. Er hat mir ganz stolz ihre Diplomarbeit gezeigt – aber auch gefragt, wozu kann man das brauchen? Kurz gesagt, man hat in etwa festgestellt, mit allen möglichen Standardabweichungen und Werten, dass es hier unten im Süden von Frankreich heiss ist.
Es braucht dringend einige Bildungsreformen – nicht nur in Frankreich, allenfalls der Schweiz – eigentlich in ganz Europa. PISA ist eine Abkürzung aber auch eine Stadt wo das Wahrzeichen auf dem Platz der Wunder fast noch gerader in der Landschaft steht, als die Resultate der Studie über Italien. Und vielleicht wird es dank Politik weiter beim Alten bleiben: Frankreich ist nicht schlecht, Deutschland Durchschnitt und die Schweiz halt doch noch etwas besser – aber sicher nicht an der Spitze. Übrigens, beim Apéro beim Nachbar hat man sich zu fünft darauf geeinigt, dass ich das Pumpenproblem selber in die Hand nehmen soll und dass sie eigentlich französische Aktien nicht mögen . zu viel Misswirtschaft. Und nun erklären sie einem Franzosen einmal Stockpicking …